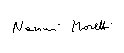IL FIGLIO DELLA
"SACHERTORTE"*
[Der Sohn der "Sachertorte"]*
Nanni Moretti, ein Filmschaffender im Sinne der "politique des auteurs"?
609 336: Seminar
zum Praxisfeld Journalismus: Filmkritik iG 8.1.3
Dr. Christa Blümlinger
SoSe 1995
Markus
A. Mascelli
Matr.-Nr.: 9003211
[ e n t e r ]
* in Anlehnung an den Film "Son of the Pink Panther" ["Der Sohn des Rosaroten Panthers"] von Blake Edwards aus dem Jahre 1993 mit Roberto Benigni, Herbert Lom und Claudia Cardinale, in dem Benigni Inspektor Clouseaus tolpatschigen Sohn spielt. Der Film war in den USA erwartungsgemäß ein Flop, in Italien hingegen (Kinotitel: "Il figlio della pantera rosa") ein großer Erfolg.

|
|
|
für S. und die sh.asus
"Ich
liebe das Kino, und vor allem liebe ich es, ins Kino zu gehen;
paradoxerweise gehen jene Leute, die heute das Kino lieben
oder sagen, sie lieben es, nicht oft dorthin."
(übersetzt nach dem Interview von Jean A. Gili mit Nanni Moretti: Nanni Moretti "Des films pour exorciser mes obsession". Entretien avec Nanni Moretti [Nanni Moretti. "Filme, um meine Obsessionen loszuwerden". Unterhaltung mit Nanni Moretti]. In: Positif, Nr. 311, Jänner 1987)
[ i n h a l t ]
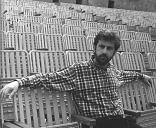
[ i n h a l t ]
2. was ist die "politique des auteurs"?
3. biographisches zu nanni moretti
4.
die wiederkehrenden elemente in nanni morettis filmen
a. michele apicella und nanni moretti
b. das ballspiel und der wasserball
c. die süßigkeiten und deren philosophie
d. die schuhe und der charakter dahinter
e. der tanz und die musik
f. das telefon und die kommunikation
g. die familie und die moral
h. der film im film und das kino
i. die psychologie und die 68er-generation
j. die sprache und die gesellschaft

"Das
Kino war und ist für mich immer das adäquate Mittel,
den anderen und mir selbst mitzuteilen, was ich alles in mir habe."
(übersetzt nach dem Interview von Charles Tesson mit Nanni Moretti: Comme un nageur solitaire ... Entretien avec Nanni Moretti [Wie ein einsamer Schwimmer ... Unterhaltung mit Nanni Moretti]. In: Cahiers du Cinéma, Nr. 31, Jänner 1987)
1. vorspann
Die vorliegende Arbeit soll klären, inwieweit und anhand welcher Indikatoren das Filmschaffen Nanni Morettis als ein Filmschaffen im Sinne der "politiques des auteurs" zu sehen ist, kurz: aufzeigen, daß es sich bei Nanni Moretti um einen Autorenfilmer im wahren und ursprünglichen Sinne des Wortes handelt. Dazu wird es nötig sein, jene wiederkehrenden Elemente filmtechnischer, inhaltlicher und symbolischer Natur aus seinen Filmen zu exzerpieren, die Teil dessen sind, was ich im Sinne der "politiques des auteurs" als die Handschrift des Regisseurs und Schauspielers Moretti bezeichen möchte, was sozusagen seinen "Stil" ausmacht. Die Bedeutung, die diese wiederkehrenden Elemente über ihre Funktion in den einzelnen Filmen hinaus für das Verständnis des filmischen Gesamtwerks Nanni Morettis als das eines "auteurs" im ursprünglichen Wortsinn (der Kritiker der Cahiers) haben, soll mit Daten aus Interviews und Filmkritiken belegt werden, die Aufschluß geben sollen über Morettis künstlerisches Selbstverständis, sein Verhältnis zum Produktionsumfeld und die Lesarten seines schöpferischen Outputs in der Filmkritik.

"Aber
meine Filme haben trotzdem nur einen Sinn,
weil ICH sie geschrieben, die Regie geführt und in ihnen gespielt habe."
(übersetzt nach einem Interview mit Nanni Moretti in "Cinéma" Nr. 350, 1986, Paris)
2. was ist die "politique des auteurs"?
Zum Verständnis dessen, was ich anhand des filmischen Werkes Nanni Morettis aufzeigen möchte, ist es notwendig, auf den Begriff "politique des auteurs" kurz näher einzugehen:
Der
Begriff "politique des auteurs, von François Truffaut wohl am treffendsten
in seinem Artikel "Une certain tendance du Cinéma français" (Cahiers du
Cinéma 31, Januar 1954) formuliert, bezeichet den von den Kritikern der
"Cahiers du Cinéma" entwickelten Ansatz, Filme vorwiegend als Werke eines
individuellen Autors ("auteur"), vornehmlich des Regisseurs, zu sehen,
"der seine persönliche Weltsicht trotz der Spannungen zwischen Stil, Thema
und Produktionsbedingungen durchsetzt." [1]
Der "auteur" (franz. für Autor), ist demnach zu sehen als ein "Regisseur
mit einem stark ausgeprägten Stil" [2]
, der sich als Individuum über sein filmisches Schaffen ausdrückt. Neu
an diesem Ansatz war die Vorstellung des "Kinos der Autoren" als eines
"Kinos der Regisseure", das z.B. im krassen Gegensatz zum klassischen
amerikanischen Modell der Trennung zwischen Drehbuchautor und Regisseur
stand. Die "politique des auteurs" ging davon aus, in der Filmkomposition
einen Organismus zu erkennen, "der auf unterschiedlichen Ebenen die individuellen
Besonderheiten des Regisseurs zum Ausdruck bringt." [3]
Als willkürliche (Neu-) Festlegung filmkritischer Herangehensweise stellte
dieser Ansatz viel eher eine "Politik" als eine Theorie im eigentlichen
Sinne dar. André Bazin versuchte dies einige Jahre später in einem Artikel,
in dem er zu einigen der durch ebendiese "Politik" entstandenen Exzesse
Stellung nahm, folgendermaßen zu erklären: "Die Politique des Auteurs
besteht kurz gesagt darin, den persönlichen Faktor in der künstlerischen
Schöpfung als Bezugspunkt zu wählen und dann anzunehmen, daß dieser sich
von einem Film zum nächsten fortsetzt oder sogar weiterentwickelt." [4]
Trotz dieser, speziell in ihrer Verallgemeinerung problematischen Positionierung
der Kritiker der "Cahiers" hat die "politique des auteurs" zumindest dem
Wiederaufleben des persönlichen Autorenfilms in den 60er Jahren Gutes
getan, indem sie als dessen Wegbereiter fungierte: "Nachdem es einmal
klar war, daß ein Film das Produkt eines Autors war, daß die 'Stimme'
des Autors bekannt war, konnten sich die Zuschauer dem Film anders als
bisher nähern, nicht so als ob er Realität wäre oder der Traum von Realität,
sondern als eine Darstellung, die von einem anderen Individuum gemacht
wurde." [5]
Auf der Ebene der Produktionsbedingungen bestimmt sich der (heutige)
Autorenfilm nach Jörg Becker "vor allem aus dem Protest gegen das, was
er nicht sein will: Der handwerkliche Autorenfilm steht gegen die Industrieproduktion
Film, also gegen einen Film, der sich nach technischem Niveau und Innovationsstärke
einschätzen läßt und der regelrechte Genres produziert. 'Autorenfilm ist
eine Protestform: gegen den Überhang des Bankdenkens, Verleiherdenkens
und Produzentendenkens im Film.' So Kluge in der Ulmer Dramaturgie.
Das autoriell Schöpferische, das Subjektive des Autors ist das Prinzip
des Autorenfilms, hier liegt das Entscheidungszentrum. Das klingt emphatisch,
nach Omnipotenz des freien Schriftstellers, der seinen unergründlichen
individuellen Impulsen folgt, dessen Filme gleichsam den Abdruck seiner
Persönlichkeit bilden, eine Welt ganz eigener Zeichen und Obsessionen."
[6]
Und genau an diesen Zeichen und Obsessionen soll meine Beschäftigung mit
den Filmen Nanni Morettis und deren Lesart in der Filmkritik ansetzen.
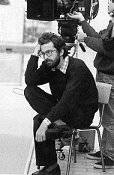
"Wenn
ich mich über etwas lustig mache, dann über mich und meine Welt.
Nur wenn man zuerst häßlich und gemein zu sich selber ist,
hat man auch das Recht, zu anderen häßlich und gemein zu sein."
("Italien 2. Glück und Melancholie. Gespräch mit Nanni Moretti von Rainer Gansera." In: epd Film 9/94)
3. biographisches zu nanni moretti
Nanni
Moretti, am 19. August 1953 in Bruneck (Südtirol) geboren, wo seine Eltern,
ein Griechisch-Professor der Universität "La Sapienza" und eine Gymnasiallehrerin,
gerade im Urlaub waren, verbringt seine Kindheit und Jugend in Monteverde,
einem gutbürgerlichen Stadtteil Roms, und schließt seine humanistische
Schulbildung mit der Matura am Klassischen Lyzeum ab. Während der Gymnasialzeit
kristallisieren sich schon seine beiden Hauptinteressen heraus: der Wasserballsport
und das Kino. Die Nachmittage gehören dem Kino, die Abende dem Training.
[7] "Während meiner letzten Jahre im
Gymnasium war ich ein begeisterter Kinogänger, aber ich war nicht krank
vom Kino. Ich habe mir alles angeschaut, auch viele schlechte Filme, denn
es ist sehr wichtig sie auch zu sehen." [8]
Er engagiert sich in einer trotzkistischen Gruppierung, gibt mit einem
Altersgenossen die Zeitschrift "Soviet" heraus und wird in den Jahren
nach 1968 in der "Außerparlamentarischen Linken" aktiv. [9]
Nach der Matura gibt er den Wasserballsport kurzfristig auf, nachdem er
es zuvor sogar bis in die Jugendnationalmannschaft geschafft hatte, um
die Möglichkeiten, Filmemacher zu werden, zu sondieren: Die Filmhochschule
in Rom ist Akademikern vorbehalten, die Akademie der Darstellenden Künste
interessiert ihn weniger, da sie viel eher eine (sehr kalte und starre
[10] ) Ausbildung zum Schauspieler
bietet als zum Regisseur. So versucht er auf direktem Wege, bei einigen
Regisseuren als Regieassistent unterzukommen, was ihm aber nicht gelingt.
[11] Er verkauft seine Briefmarkensammlung
und schafft sich eine Super8-Kamera an.
Morettis erste autodidaktische Fingerübungen, zirka dreißigminütige Kurzfilme,
sind von sehr experimentellem Charakter ("La sconfitta", 1973;
"Paté de bourgeois", 1973; "Come parli frate?", eine Parodie
auf A. Manzonis "I promessi sposi", 1974). [12]
1976 spielt Moretti eine kleine Rolle in "Padre Padrone" der Brüder
Taviani.
1976 dreht er auf Super8 (1977 auf 16mm umkopiert) seinen ersten Langfilm
"Io sono un autarchico", der auf verschiedenen Festivals und in
mehreren Filmclubs vorgeführt wird und zum ersten Mal jene Elemente enthält,
die für Nanni Morettis Filme typisch werden, weil immer wieder wiederkehrend,
so z.B. die Hauptfigur des Films (und - beinahe aller - weiteren Filme
Morettis), Michele (Apicella), das alter ego des Regisseurs.
1978 dreht Moretti seinen ersten "professionellen" Film auf 16mm-Material,
später umkopiert auf 35mm, "Ecce Bombo", der Italien in Cannes
vertritt und ein unerwarteter kommerzieller Erfolg wird. Auf ihn folgt
1981 "Sogni d'oro", der den Goldenen Löwen in Venedig gewinnt,
1984 "Bianca" (von Silvio Berlusconis Reteitalia produziert; Morettis
Kommentar dazu: "Für mich war es eine Finanzierung. Für ihn war es ein
Alibi." [13] ), 1985 "La messa
è finita", für den Moretti in Berlin den Silbernen Bären erhält. Was
erstaunt, ist, daß der immer noch junge Regisseur bereits ganz früh in
seiner Laufbahn als Filmemacher zu den Hochprämierten des europäischen
Kinos zählt.
1987 gründet Nanni Moretti zusammen mit Angelo Barbagallo eine eigene
Produktionsfirma, die "Sacher-Film", benannt nach der Sacher-Torte, in
die Moretti so vernarrt ist. In Zusammenarbeit mit der Rai und ausländischen
Gesellschaften produziert die "Sacher-Film" 1987 "Notte italiana" von
Carlo Mazzacurati und 1988 "Domani accadrà" von Daniele Luchetti, in dem
Moretti selbst mitspielt. 1989 erscheint, von Morettis "Sacher-Film" produziert,
"Palombella rossa", der bei den Filmfestspielen in Venedig großes
Aufsehen erregt, da seine Produktionsform als Absage an den "üblichen
Produktionsweg" verstanden wird, [14]
was dazu führt, daß der Film für den Wettbewerb abgelehnt wird und es
nur in die "Settimana della critica" schafft. 1990 dreht Moretti für Raitre
den einstündigen 16mm-Dokumentarfilm "La Cosa" über die Diskussionen,
die die Meldung einer möglicherweise bevorstehenden Umbenennung der KPI
in "Partei der Demokratischen Linken", PDS, in den KPI-Parteisitzen des
Landes auslöst. Im gleichen Jahr widmet André S. Labarthe Moretti eine
Folge seiner Serie "Cinéma de notre temps". 1991 produziert die "Sacher-Film"
Daniele Luchettis "Il portaborse", in dem Moretti eine der beiden
Hauptrollen spielt. 1991 eröffnet Nanni Moretti im römischen Stadtviertel
Trastevere sein eigenes Programmkino "Nuovo
Sacher" und 1993 erscheint "Caro diario", für den Moretti in
Cannes den Preis für die beste Regie erhält. Es folgt die Produktion von
Mimmo Caloprestis "La seconda volta", in der Moretti wieder einmal
eine Hauptrolle übernimmt und Morettis jüngster Film, "Aprile",
der demnächst in den österreichischen Kinos anlaufen müßte.

"Die
Schwierigkeit mit anderen zu sein, konstituiert das Thema meiner Filme,
deren wahres Thema die Schwierigkeit, mit sich selbst zu sein ist."
(übersetzt nach einem Interview mit Nanni Moretti in "Cinéma" Nr. 350, 1986, Paris)
4. die wiederkehrenden elemente in nanni morettis filmen
"Die Wandlungen, die es bei mir von Film zu Film gibt, machen mein Kino aus. Herauszubekommen, was ich über meine Filme denke, geht vielleicht so: Sie müssen sich immer den nachfolgenden Film anschauen. Vom nachfolgenden Film her verstehen Sie, was ich über den vorangegangenen denke. Die Entscheidungen, die ich als Regisseur treffe, spiegeln immer auch meine Erfahrungen als Zuschauer." [15] Dieser Äußerung Morettis entsprechend und der Ansicht von Holzinger folgend, daß es sich bei Nanni Morettis Kino um einen Kosmos handelt, der sich dem Zuschauer erst in einer Art "Fortsetzungskino", aus der Gesamtheit der Filme erschließt, [16] habe ich die wesentlichen Elemente inhaltlicher und stilistischer Natur aus Nanni Morettis Filmen (von "Ecce Bombo" bis "Caro diario") zu Begriffspaaren zusammengestellt, die gleichzeitig schon grob einen Aufschluß darüber geben, wofür sie innerhalb des Kino-Kosmos Nanni Morettis stehen.

a. michele apicella und nanni moretti
Wesentlich
für das Kino des Nanni Moretti ist das (fast lückenlose) Festhalten an
ein und derselben Hauptfigur in seinen Filmen. [17]
Michele Apicella, von der Kritik immer wieder als alter ego Morettis
identifiziert, ist ein fiktives Konstrukt aus einem Vornamen, der Moretti
"das erste Mal ... rein zufällig eingefallen" [18]
ist und ihm recht geeignet vorkam, und dem Mädchennamen seiner Mutter:
"Es schien mir ein schöner Vorname zu sein, ein bißchen traurig, weder
besonders originell noch besonders gewöhnlich, wie es Gianni, Andrea,
Fabrizio, Gianfranco sein können. Dann habe ich ihn weiterverwendet, denn
das erschien mir natürlich, sogar logisch. Und dann hat ein Spiel begonnen,
das noch andere Sachen als den Namen miteinbezog. Ich behalte unbewußt
die Charaktereigenheiten des Protagonisten meiner Filme bei, weil es eine
Person ist, die von mir ausgeht." [19]
Als fiktive Figur ist Michele (seit Morettis drittem Film, "Sogni d'oro",
als Michele Apicella bekannt) auch nicht gleichzusetzen mit Nanni Moretti,
was Moretti in mehreren Interviews immer wieder zu betonen bemüht ist:
[20] "Meine Figuren sind in dem Sinn
autobiographisch, als sie einen Seelenzustand, der mir in einem bestimmten
Moment eigen ist, repräsentieren und meine Gefühle ausdrückt." [21]
"In den Filmen, die ich mache - nennen wir sie persönlich, autobiographisch
- versuche ich, meine Ängste loszuwerden, meine Obsessionen, sie mit jener
Waffe zu bekämpfen, die unvermeidlich ist, wenn man sich der Autobiographie
ausliefert, nämlich der Ironie." [22]
Auf die Tatsache angesprochen, daß seine Hauptfigur in "La messa è
finita" das erste und einzige Mal nicht Michele (Apicella) heißt,
erwidert Moretti in einem Interview mit Jean A. Gili für Positif:
"Vielleicht heißt der Protagonist von 'La messa è finita' auch Michele.
Ich glaube, daß die Priester oft ihren Namen ändern, wenn sie ihr Priesteramt
antreten. Hier heißt er Don Giulio - Don Michele, das würde nicht gut
klingen - aber vielleicht hieß er ja Michele vor seiner Priesterweihe."
[23]
Den eigentlichen Wandel vollzieht Nanni Moretti mit "Caro diario",
wo er sich erstmals nicht hinter dem durchaus mit biographischen Zügen
ausgestatteten, aber doch immer noch erfundene Kunstfigur gebliebenen
Michele Apicella versteckt, sondern erstmals als Nanni Moretti auftritt.
Diese Entscheidung begündet er in der besonderen Beschaffenheit des Erzählstoffes
und dem Anliegen, dies auch in der Wahl der filmischen Darstellungsform
zum Ausdruck zu bringen. [24] Speziell
im III. Kapitel "Medici" ["Ärzte"] (aber auch im I. Kapitel "In vespa"
["Auf der Vespa"]), wäre es unsinnig gewesen, sich hinter einer fiktiven
Person zu verbergen. Der Nanni Moretti des II. Kapitels "Isole" ["Inseln"]
trägt noch am ehesten die Züge des Michele Apicella (Das gesamte Kapitel
ist dramaturgisch den früheren Moretti-Filmen am ähnlichsten.). Allerdings
ist diese Figur ruhiger geworden, mehr in den Hintergrund getreten, hört
erstmals zu und verzichtet darauf, der "künstlerische Direktor des Privatlebens
seiner Freunde" (Filmzitat aus "Caro diario") zu sein. [25]
Den Ansatz für diesen Wandel hat Moretti unbewußt schon in "Palombella
rossa" gelegt, wo er einen kommunistischen Parteifunktionär und Wasserballer
spielt, der nach einem Autounfall das Gedächtnis verloren hat und nicht
mehr weiß, wer (oder auf der Ebene der politischen Kritik: was?) er ist:
"Aber mir ist für den Gedächtnisverlust, von dem PALOMBELLA ROSSA erzählt,
Jahre später noch ein anderer Grund klar geworden. Ich wollte wohl, ohne
daß mir dies damals bewußt gewesen wäre, mit einer neuen Person, wie von
einem Nullpunkt aus, neu anfangen." [26]

b. das ballspiel und der wasserball
Die
Bedeutung, die das geschickte Hantieren mit Bällen oder anderen Gegenständen
(Tassen, Tellern, etc.), die Freude am Fußballspiel, die Liebe zum Wasser
und zum Schwimmen u.ä. in den Filmen Nanni Morettis haben, findet ihren
biographischen Ursprung in der Tatsache, daß Nanni Moretti als Jugendlicher
selbst Leistungssport betrieben hat, und zwar als Wasserballer für den
Club Lazio. 1970 wurde er sogar in die Jugendnationalmannschaft berufen,
unterbrach aber seine sportliche Karriere in den frühen 70er Jahren. Die
sogenannte "palombella" (ital. ornithologische Fachbezeichnung für die
Hohltaube, eine Taubenart) ist ein Fachausdruck aus dem Wasserballsport
und bezeichnet eine bestimmte Art von extrem angeschnittenem Wurf, der
zu Morettis Wasserballerzeiten eine seiner Spezialitäten war.
War die Andeutung des Ballspielens in Morettis ersten fünf Filmen, aber
auch in "Caro diario" eher unterschwellig bis beiläufig (das gedankenversunkene
Werfen und Fangen einer Tasse, eines Metermaßes oder eines Tennisballs
in "Ecce Bombo" oder "La messa è finita", das Ausrollen
eines grünen Teppichs und das Aufstellen eines Miniaturtores in "Sogni
d'oro", das beiläufige Dribbeln eines Fußballs in "Bianca",
die Fußballspiele mit den Kindern in "La messa è finita" oder das
Fußballtor in "Caro diario", das in der von der Kritik vielfach
als Antonioni-Zitat (fehl- bzw. über-) interpretierten Szene mit dem langsam
vorbeifahrenden Schiff wie zufällig ins Bild kommt), widmete Moretti seinen
ersten selbstproduzierten Film "Palombella rossa" ganz dem Wasserballsport:
Kammerspielartig siedelt er die Geschichte Michele Apicellas, eines Kandidaten
der KPI und Wasserballers, der nach einem Autounfall sein Gedächtnis verloren
hat, in die metaphorisch aufgeladene Situation eines Wasserballmatches,
das für den Protagonisten bzw. die KPI zur Parabel für die Wiederfindung
der persönlichen bzw. politischen Identität wird.

c. die süßigkeiten und deren philosophie
Seine
persönliche Vorliebe für Süßigkeiten und Torten, insbesondere die Wiener
Sachertorte, hat Nanni Moretti auch in der Figur des Michele Apicella
beibehalten und zu einem wiederkehrenden Element in seinen Filmen gemacht,
durch das er immer wieder groteske Situationen oder Dialoge schafft: Ob
er nächtens seine beiden Regieassistenten ("Sogni d'oro") zu einem
"wunderschönen Ort" [27] führt, nämlich
"einer der wenigen Konditoreien in Rom, in der man die Sachertorte macht"
[28] , um vor der üppigen Auslage
andächtig die Torten und Süßspeisen zu bewundern, oder in "Bianca"
am Essenstisch beim Dessert einen philosophischen Diskurs über die Mont-Blanc-Torte
vom Stapel läßt und seinen Gastgeber rügt, weil dieser einen Tunnel in
die Süßspeise bohrt, was man nicht macht, weil die Torte "auf einem delikaten
Gleichgewicht aufbaut" [29] , oder
er seinen emotionalen Frust an einem überdimensionalen Glas Nutella ausläßt
("Bianca"), ob er in "La messa è finita" vom Altar herunter
seine Schwester fragt, ob sie sich noch an die Nugatine erinnert, "Hälfte
Schokoriegel, Hälfte Bonbon" [30]
, die sie immer von ihrer Mutter bekommen haben, oder ob er in "Palombella
rossa" ständig von irgendwelchen Parteikollegen verfolgt wird, die
ihn mit Torten und Süßspeisen für ihre Sache wohlgesinnt stimmen wollen,
immer wieder brechen in der Figur des Michele Apicella (Don Giulio) ganz
bewußt Wesenszüge Nanni Morettis, dem ebenfalls Naschhaftigkeit nachgesagt
wird [31] , durch. "Die Süßspeisen
stehen für sinnlichen Genuß, den schon der bloße Anblick durch eine Konditoreivirtine
verspricht und eine fast kindliche Freude an den einfachen Dingen im Leben.
Sie bieten vor allem aber Kompensation und Trost, lassen die Welt rundherum
vergessen oder stimmen zumindest versöhnlich. (...) Eine süße Ersatzwelt,
die der Filmemacher Nanni Moretti in seiner [ihrer; A.d.V.] ganzen symbolischen
Funktionalität einsetzt, um scheinbar Unsagbares, Unanschauliches, wie
die Einsamkeit des Anti-Helden Michele, auszudrücken. (...) Micheles Ersatzwelt
des Süßen ist in den Filmen um so präsenter je problematischer, neurotischer
sich die zwischenmenschlichen Beziehungen gestalten." [32]
Was speziell die Vorliebe Morettis für die Wiener Sachertorte anlangt,
so ist diese längst zu einem Markenzeichen geworden, das über seine Filme
hinausreicht. [33] Es mutet fast
schon rührend an, wenn Moretti in einem Interview mit Rainer Gansera als
eines der wiederkehrenden Elemente in seinen Filmen die Naschhaftigkeit
der Hauptfigur(en) anspricht und im gleichen Atemzug in einer Mischung
aus Andacht und Stolz recht selbstverliebt anmerkt: "Der Sachertorte zu
Ehren heißt übrigens meine Produktionsfirma 'Sacher-Film', mein Kino in
Rom 'Nuovo Sacher'." [34]

d. die schuhe und der charakter dahinter
Das
Besondere Verhältnis zu Schuhen und dazu, was diese über deren TrägerInnen
aussagen, läßt sich am besten mit folgender Äußerung aus "Bianca"
beschreiben: "Jeder Schuh eine Gangart, jede Gangart eine unterschiedliche
Weltanschauung." [35] Kommt die Schuh-Fixierung
auch in den früheren Filmen mal mehr, mal weniger eindeutig und bedeutungsvoll
vor (in "Ecce Bombo" leitet der Reporter des freien Jugendsenders
Telecalifornia einen Beitrag über ein Jugendzentrum mit einem Diskurs
über "Zoccoli" ("Clocks", Holzschuhe) und Feministinnen ein, in "Sogni
d'oro" sucht der Filmemacher Michele Apicella die Schauspieler für
seinen nächsten Film nach deren Schuhen aus), so erklärt Moretti/Michele
den symbolischen Gehalt des Schuh-Themas so richtig erst in "Bianca",
wo der Mathematikprofessor Michele in seinem Schuldgeständnis zur Begründung
der von ihm verübten Morde ständig in die Schuh-Metaphorik ausweicht:
"Früher war es leichter zu urteilen, wie mit den Schuhen: Es gab nur einige
Modelle, sehr charakteristische, es war der Schuhtyp und schluß. Heute
hingegen ist alles konfuser, ein Stil hat sich mit dem anderen vermischt
... Die Dinge sind nicht mehr eindeutig." [36]
In "Bianca" gibt es noch eine Reihe weiterer Szenen zum Thema Schuh-Fixierung,
so z.B. das erste Gespräch zwischen Michele und Bianca ("Schöne Schuhe,
normalerweise gefallen mir Schuhe mit hohen Absätzen nicht." [37]
), die Szene, in der der Kommissar bemerkt, daß Michele einen Schrank
voll gleicher Schuhe besitzt, oder die Schlußszene, in der Michele begründet,
wieso er sich entschlossen hat, dem Kommissar die Morde zu gestehen ("Und
als ich Ihre Schuhe gesehen habe, habe ich alles von Ihnen verstanden:
Sie sind ein Mann der gelitten hat, der jeweils nur ein Paar Schuhe hat,
die sich abnutzen, zerschleißen, die Farbe verlieren. Als ich Ihre Schuhe
gesehen habe, habe ich gedacht: Jetzt sage ich es ihm gleich." [38]
).
Dabei sind Moretti/Michele immer die einfachen, unaufdringlichen, klassischen
Schuhmodelle sympathisch (siehe oben zitierte Szene aus "Sogni d'oro"),
da diese einen Rückschluß auf einen gewissen Lebensstil bzw. eine bestimmte
Haltung seitens ihrer TrägerInnen zulassen. [39]
In den auf "Bianca" folgenden Filmen ist der Schuh-Fetischismus
Morettis/Micheles unauffälliger: In "La messa è finita" regt sich Don
Giulio darüber auf, daß ihn die Gastgeberin in Pantoffeln empfängt, wenn
sie ihn zum Essen einlädt, in "Palombella rossa" erzählt Micheles
Tochter einer Reporterin, die sie zu ihrem Vater befragt, daß sie mit
ihm eigentlich nie über Politik spricht, sondern über Kleider und darüber,
was sie anziehen soll, und daß der Streitpunkt dabei immer die Schuhe
sind, und in "Caro diario" macht Nanni Moretti, als er in Rom zufällig
auf Jennifer Beals trifft, ganz beiläufig eine Bemerkung über ihre Schuhe
("Diese Schuhe müssen sehr beqeuem sein." [40]
).

e. der tanz und die musik
Tanz
oder Musik (speziell der italienische Schlager) bzw. die Jukebox spielen
entgegen der Ansicht von Jousse und Saada [41]
in Nanni Morettis Filmen nicht erst seit dem Bekenntnis in "Caro diario"
eine wichtige Rolle: "In Wirklichkeit war mein Traum immer der, gut tanzen
zu können. 'Flashdance' hieß der Film, der mein Leben definitiv verändert
hat. Es war ein Film nur übers Tanzen. Tanzen können ... aber letzten
Endes beschränke ich mich nur aufs Zuschauen, was auch schön ist, aber
ganz was anderes." [42] In den Filmen
davor gibt es immer wieder dramaturgisch "unmotivierte" und im Vergleich
zu konventionellen Erzählmustern im Kino deplaziert wirkende Tanzszenen,
die Morettis emotionale Verbundenheit zum Tanz als Ausdruck von Freude,
Zuneigung und Harmonie jenseits der sprachlichen Mittel belegen. Er inszeniert
diese Szenen dabei immer als einen zarten, fragilen Moment in dem alle
Worte unzulänglich wären, das Gefühl zu beschreiben, das sie zum Ausdruck
bringen. Oft sind sie ein Mittel dazu, Verbundenheit auszudrücken (z.B.
die Tanzszenen in "Ecce Bombo" oder "La messa è finita"),
andere Male ein Mittel dazu, Isolation aufzuzeigen (z.B. jene in "Sogni
d'oro", in der alle Filmleute am Set von "La mamma di Freud" tanzen,
nur Michele, der Regisseur, sich einsam und aufgrund seiner emotionalen
Verschlossenheit ausgeschlossen fühlt).
Für Morettis Vorliebe für den Einsatz von italienischen Schlagern in seinen
Filmen gibt es ebenfalls eine Reihe von Belegen: In "Ecce Bombo"
sagt Micheles Mutter, als sie über die "Jugend von heute" spricht, "Kommt
mir nur mit Lucio Battisti", und einpaar Szenen weiter singt Micheles
Vater, im Bett, neben seiner Frau liegend, "Anna" von Lucio Battisti.
An einer anderen Stelle des Films bemerkt Mirko, ein Freund Micheles:
"Ich werde eine Platte von Gino Paoli auflegen. Zur Zeit höre ich sie
mir oft an, um die Traumata von vor fünfzehn Jahren wieder aufleben zu
lassen." [43] In "Bianca"
hält der Geschichtelehrer der "Marilyn Monroe"-Schule eine Lektion über
die Sechziger Jahre zu den Klängen von Gino Paolis "Il cielo in una stanza",
die aus der Jukebox erklingen, die im Klassenzimmer steht. Ebenfalls in
"Bianca" schickt sich das Lehrerkollegium bei Antritt des Schulausflugs
gerade in dem Moment, in dem Michele Bianca zum erstenmal erblickt, an,
den Refrain zu "Dieci ragazze per me" ["Zehn Mädchen für mich"] von Lucio
Battisti anzustimmen. In "La messa è finita" schaltet Don Giulio
das Radio ein, während ihm seine Schwester Valentina einen Brief vorliest,
und es lauft "Bellissima" von Loredana Bertè und das Lied übertönt sogar
die Stimme Valentinas. Das sind nur einige wenige Beispiele, deren es
natürlich noch mehrere geben würde.

f. das telefon und die kommunikation
Das
Telefon spielt in Manni Morettis Filmen immer wieder eine wichtige Rolle.
Als Metapher für den Verfall der Kommunikation setzt es Moretti immer
wieder für den Versuch seiner Protagonisten ein, über mehr oder weniger
große Distanz die eigene Einsamkeit zu überwinden. Wenn in "Ecce Bombo"
Olga Freunde anruft, um nicht allein zu sein, geschieht dies aus demselben
Grund, der Mario dazu bewegt, ständig bei der Talksendung im Radio anzurufen
und davon zu erzählen, was ihm sein äthiopischer Freund erzählt hat. All
die Telefonate, um abzuchecken, was man am Abend machen könnte, um auszumachen,
daß man Olga besuchen gehe, der es gerade nicht so gut gehe, oder einfach
nur die Szene, in der Michele und seine Freunde ein Mädchen anrufen, um
ihr eine Arie aus Giacomo Puccinis "Tosca" vorzuspielen, oder jene in
der Michele Flaminia anruft, um ihr recht tolpatschig zu sagen, daß er
sich in sie verleibt habe, stehen für ein und dieselbe Kommunikationsarmut,
die sich auch in den Gesprächen der Filmfiguren feststellen läßt. Indirekt
ist das Auf-Band-Aufnehmen der Selbstfindungssitzungen genauso eine Ersatzhandlung
und eine Schutzhaltung davor, offen und unvermittelt miteinander zu reden.
In "Sogni d'oro" wird Michele ständig von Nicola angerufen, der
unbedingt bei ihm Regieassistent werden will, um selbst einmal Regisseur
zu werden (biographische Anspielung!). In "Caro diario" setzt Nanni Moretti
das Telefon wieder als Mittel ein, die Abarten unserer Kommunikationsweisen
bloßzustellen, indem er auf Salina, einer der Liparischen Inseln, das
Regiment den Kindern übergibt, die in nicht mehr enden wollenden Telefonaten
die Gespräche genauso monopolisieren wie die ihnen von ihren Eltern entgegengebrachte
Aufmerksamkeit.
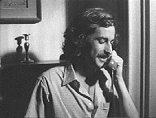
g. die familie und die moral
Die Einbettung der Filmfiguren in die Aufgehobenheit einer bürgerlichen Familiensituation mit Söhnen und Töchtern, die noch bei den Eltern leben, Familienessen mit den dazugehörigen Streits oder die Wunsch- ("La messa è finita") bzw. Zwangsvorstellung ("Bianca"), von intakten Familienverhältnissen umgeben sein zu wollen, bilden einen weiteren Eckpfeiler in Nanni Morettis Filmwelt. Ob nun die Protagonisten zu Hause leben und sich gegen die Eltern auflehnen, ohne jedoch je ernsthaft ans Ausziehen zu denken wie in "Ecce Bombo" oder "Sogni d'oro", oder die familiäre Einbettung wie ein warmer Schoß empfunden wird, den man ungewollterweise verlassen hat müssen, in den man sich aber gern zurücksehnt oder -flüchtet, wenn man Probleme hat, bzw. an den man sich gern zurückerinnert (siehe Schlußszene), wie in "La messa è finita", ob das ödipale Verhältnis zur Mutter thematisiert wird, wie dies in "Sogni d'oro" gleich zweifach der Fall ist (der Mutterkomplex des Filmemachers Michele Apicella und der Mutterkomplex des Sigmund Freud im Film "La mamma di Freud", den Michele Apicella dreht), oder die Familiensituation von vernachlässigten ("Palombella rossa") oder zu viel behüteten Kindern ("Caro diario") dargestellt wird, immer sind diese Situationen eine mikrokosmische, z.T. liebevoll karikierte Darstellung der realen Verhältnisse in Italien in ihren unterschiedlichen Ausprägungen, das als eines der Länder gilt, in denen die Kinder im Vergleich zum europäischen Schnitt am längsten in der Obhut der eigenen Familie verbleiben. Gleichzeitig vermitteln die in den Filmen Morettis dargestellten Familiensituationen ein Bekenntnis zu sehr bürgerlichen und wertkonservativen Familienmustern.
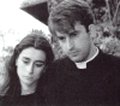
h. der film im film und das kino
Die
filmrekursiven Elemente in Nanni Morettis Kinowelt setzten gleich auf
mehreren Ebenen an: In den früheren Arbeiten Morettis ("Ecce Bombo",
"Sogni d'oro") "findet eine rege Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen
italienischen Kino", und vor allem eine heftige Polemik gegenüber der
italienischen Komödie (Alberto Sordi, Nino Manfredi, Lina Wertmüller)
und dem engagierten Politkino statt, [44]
denen Moretti eine Überholtheit der Inhalte bzw. eine Festgefahrenheit
der gestalterischen Formen vorwirft. [45]
In "Sogni d'oro" erfolgt, dramaturgisch als Film-im-Film angelegt,
eine Beschäftigung mit dem Produktions- und Rezeptionsumfeld des Kinos,
die Moretti, was das Rezeptionsumfeld anbelangt, in "Caro diario"
mit dem Sujet des Filmkritikers, der sich vor Schmerzen windet, wenn man
ihm seine eigenen Filmkritiken vorliest, fortführt. Morettis Feststellung,
daß sich seine Ansicht über einen seiner Filme immer aus dem folgenden
Film herauslesen läßt, [46] und Holzingers
Auffassung des Kinos von Nanni Moretti als eines "Fortsetzungskinos" [47]
folgend, karikiert Moretti in "Sogni d'oro" die Aufnahme seines
vorhergehenden Filmes bei Publikum, Kritikern und Kollegen über die Figur
des Filmemachers Michele Apicella und dessen letzten Film (der Bezug zu
"Ecce Bombo" ist unübersehbar, für beide ist der aktuelle Film
der dritte): "Ich glaube nicht, daß ein lukanischer Tagelöhner, ein Hirte
aus den Abruzzen, eine Hausfrau aus Treviso besonders interessiert sein
können an diesem häßlichen, vulgären, geschmacklosen Film über Kommunikationsprobleme,
Langeweile, schwierige Beziehungen zu Frauen." [48]
Gleichzeitig reflektiert "La mamma di Freud" als Film im Film inhaltlich
eines der Themen des Filmes selbst, nämlich das Verhältnis des Protagonisten
(Michele Apicella/Freud) zu dessen Mutter. Eine andere Ebene der Beziehung
auf das Kino erfolgt sowohl in "Ecce Bombo" als auch in "Sogni
d'oro" in der Stilisierung bestimmter Dialogszenen als Filmtakes mit
Wiederholung derselben, wenn sie einem der Gesprächspartner nicht gefallen
haben ("Die hat mir wirklich gefallen, wiederholen wir sie?" [Sie wiederholen
den Dialog.] "Die erste war besser." [49]
).
Ein durchgängigeres Motiv ist hingegen die Referenz an (mögliche, von
Kritikern oft zitierte) Vorbilder, die in mehreren Filmen auftaucht (Anspielung
auf Fellini und Buster Keaton-Poster in "Ecce Bombo", Foto von
Moretti selbst mit Super8-Kamera in "Sogni d'oro", Bild von Jerry
Lewis und Dean Martin in "Bianca", Ausschnitte aus "Doktor Schiwago"
in "Palombella rossa"). In "Sogni d'oro" karikiert Moretti
seine eigene Arbeitsweise, [50] indem
er Michele Apicella eine der eigenen z.T. genau entgegengesetzte Arbeitsweise
auf den Leib schreibt (ohne Drehbuch, mit improvisierenden Schauspielern,
in vollster Identifikation mit dem Thema etc.), erst im Kapitel "Isole"
aus "Caro diario" gewährt er den ZuschauerInnen einen Einblick
in seine Vorgehensweise bei der Vorbereitung eines Films.
Ein eigenes Kapitel stellt Morettis Kritik am Fernseh- und Unterhaltungswesen
dar, die speziell in "Sogni d'oro" anhand der Game-Show, in der
zwei Filmemacher einander messen und um die Gunst des Publikums buhlen,
und in "Caro diario" im Kapitel "Isole" anhand der Figur des Gerardo
ansetzt, der nach drei Jahren völliger Fernsehabstinenz dem Medium mit
all seinen Show-Sendungen und Soap operas komplett verfällt. Moretti
umschreibt den Grundkern seiner Kritik am besten in einem Interview mit
Gernot Zimmermann für die WirtschaftsWoche: "Es gibt in Italien keine
Staatsbürger mehr, nur mehr Fernsehzuschauer", [51]
und legt damit im Lande eines Silvio Berlusconi auch die politische Dimension
seiner Kritik dar.
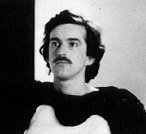
i. die psychologie und die 68er-generation
Was die Psychologie betrifft, so setzt sie in Nanni Morettis Filmen (fast) immer dort an, wo die Auswüchse oder Folgen der 68er-Bewegung bzw. dessen was aus ihr und ihren Kindern geworden ist, auftreten: Sind es in "Ecce Bombo" die Selbsterfahrungssitzungen mit den Freunden, ist es in "Sogni d'oro" die ironische Darstellung der Filmindustrie und ihrer Exponenten (in "Sogni d'oro" steht sogar der Erfinder der Psychoanalyse und dessen gestörtes Verhältnis zur Mutter im Mittelpunkt des Films im Film), in "Bianca" das gestörte Verhältnis zu zwischenmenschlichen Beziehungen und das manische Bedürfnis nach Harmonie im Leben (anderer), in "La messa è finita" die Unfähigkeit Don Giulios über die eigenen Probleme hinweg, seinen Freunden zu helfen, in "Palombella rossa" die Festgefahrenheit der Politsprache und die Überholtheit eines bloßen Festhaltens an leeren Ideologien und politischen Inhalten innerhalb der Kommunistischen Partei, in "Caro diario" die allgemeine Kommunikations- und Verhaltensgestörtheit der durchschnittlichen (Unterhaltungs-) Gesellschaft, immer wieder demaskiert Moretti jenes Umfeld, das er kennt, dem er angehörte oder noch angehört.
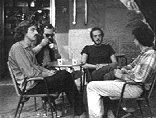
j. die sprache und die gesellschaft
Nanni Moretti parodiert in seinen Filmen immer wieder die Sprache des speziellen Mikromilieus in dem die Filme jeweils spielen. Ob er sich in "Ecce Bombo" über die ideologisierenden, aber trotzdem leeren Phrasen der 68er-Generation lustig macht und sie als Worthülsen demaskiert, oder gegen die Verrohung und "Vermailänderung" des Römischen ankämpft (Mutter: "Wie geht es der Silvia?" Michele: "Silvia, nicht die Silvia, Mama, glücklicherweise sind wir in Rom, nicht in Mailand, die Silvia, der Giorgio, der Pannella, der Giovanni, cacare [scheißen], nicht cagare [scheisen], fica [Fotze], nicht figa [Foze; die glottologische Korrelation läßt sich im Deutschen nicht entsprechend wiedergeben]." [52] ), ob sich Morettis Michele Apicella in "Sogni d'oro" der selbstverliebten manierierten Sprache eines intellektuellen Filmemachers bedient oder sich in "Palombella rossa" gegen die unbesonnene Verwendung der Worte wehrt ("Man darf keinen kriminellen Gebrauch der Worte betreiben." [53] ), über alles kann als eine Art Leitmotiv der Ausspruch aus "Palombella rossa" gestellt werden: "Wer schlecht spricht, denkt schlecht, lebt schlecht." [54]

"Bis
jetzt ist es mir in meinen Filmen gelungen, von mir ausgehend anderen
etwas mitzuteilen.
Indem ich über mich spreche, spreche ich auch über andere.
Aber ich nehme mir nicht vor, gesellschaftlich repräsentativ,
etwa das 'Symbol einer Generation' zu sein,
wie das manchmal gesagt wurde."
("Italien 2. Glück und Melancholie. Gespräch mit Nanni Moretti von Rainer Gansera." In: epd Film 9/94)
5. moretti und die filmkritik
Es
gibt eine Handvoll Zuschreibungen zum Filmschaffen Nanni Morettis seitens
der Filmkritiker, die sich z.T. mit der eigenen Einschätzung Morettis
nicht decken. Moretti bekennt selbst, immer wieder wiederkehrende Elemente
in seinen Filmen einzusetzen: "Es gibt diese Art von Spiel, das daraus
besteht, immer auf einige Leitmotive zurückzukommen, einige immer wiederkommende
Themen, Schokolade, Kuchen, der Tennisball, mit dem ich zu Hause spiele,
die Familie, die Mahlzeiten mit der Familie, der Ball, mit dem ich geschickt
umgehe, das Tanzen, die Jukebox ..." [55]
Diese wiederkehrenden Elemente werden von den Filmkritikern zwar als solche
erkannt, allzu oft passiert aber, von ihnen ausgehend eine weitgehende
Gleichsetzung der durch sie charakterisierten Filmfigur Michele Apicella
mit Nanni Moretti. Daß diese Identifikation Morettis mit seinem filmischen
alter ego durchaus berechtigt ist, seine Filme aber trotzdem nicht
als reine Autobiographie zu lesen sind, hat Moretti in meheren Interviews
(vor allem zu Beginn seines filmischen Schaffens) präzisiert (vgl. dazu
Abschnitt 4.a. "michele apicella und nanni moretti"). [56]
Deutlicher noch distanziert sich Moretti von der Ansicht, sein Filmschaffen
hätte etwas selbsttherapeutisches an sich: "Autobiographie einverstanden,
aber Selbsttherapie nein, ich drehe nicht Filme, um meine Probleme zu
lösen - das ändert nichts, ich fühle mich nicht besser, wenn ein Film
fertig ist -, sondern weil ich gerne über den Umweg des Kinos kommuniziere."
[57] Gleichzeitig gesteht Moretti
aber ein: "In den Filmen, die ich mache - nennen wir sie persönlich, autobiographisch
- versuche ich, meine Ängste loszuwerden, meine Obsessionen, sie mit jener
Waffe zu bekämpfen, die unvermeidlich ist, wenn man sich der Autobiographie
ausliefert, nämlich der Ironie." [58]
In Anlehnung an den Titel seines ersten abendfüllenden Filmes "Io sono
un autarchico" haben diverse Filmkritiker diesen des öfteren als programmatische
Vorwegnahme des von Moretti in weiterer Folge eingeschlagenen künstlerischen
Weges verstanden: "'Ich bin Autarkist' ... wird oft so verstanden, als
sei es von Anfang an sein [Morettis; A.d.V.] Bestreben gewesen, als Filmemacher
'autark' zu sein und alles alleine zu machen (...) Tatsächlich aber hat
dieser Titel gar nichts zu tun mit den Ambitionen eines total filmmakers.
Er bezieht sich allein auf das Gefühlsleben des Helden und ironisisert
die Tatsache, daß dieser von seiner Frau verlassen worden ist." [59]
Ein besonders gespanntes Verhältnis hat Nanni Moretti zur italienischen
Komödie. Seine Filme, vor allem die früheren, wurden öfters als durchwegs
"komisch" und als frischblutige Weiterentwicklung des komischen Kinos
in der Tradition der italienischen Komödie profetisiert, was wohl von
allen Werkinterpretationen am weitesten von der (Selbst-) Auffassung Morettis
und seinen Intentionen entfernt ist: "Über meine ersten Filme hat man
gesagt, daß sie die italienische Komödie aktualisieren, auf die Höhe der
Zeit bringen würden. Eine Bemerkung, die mir nicht gefällt, weil in den
siebziger Jahren von der italienischen Komödie nichts mehr vorhanden war.
Prinzipiell unterscheidet sich meine Arbeit durch eine methodische Differenz,
die meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Ich spreche von meinem
Ambiente, meiner Welt. Hingegen zeigt die italienische Komödie, gerade
auch in ihren besten Beispielen, immer Ambientes, die verschieden sind
von denen der Drehbuchautoren und Regisseure dieser Filme. Diese Autoren
und Regisseure machten sich über eine Welt lustig, die jenseits ihrer
eigenen lag." [60] (vgl. auch: "Meine
Filme haben eine ganz andere Methode als die italienische Komödie: Ich
mache darin eine Analyse meiner sozialen Situation, meiner politischen
Generation, und das inszeniere ich, ich mache mich darüber lustig. Während
die italienische Komödie - im besten Fall - andere soziale Milieus, das
Arbeiter- oder Bürgermilieu hervorhebt, aber nicht das eigene." [61]
)
Ähnlich kritisch steht Nanni Moretti dem vorgeblich engagierten politischen
Kino gegenüber: "Jene, die vorgeblich 'politisches Kino' machen, sind
oft damit zufrieden, ein 'wichtiges Thema' in den Händen zu halten, um
dann daraus einen häßlichen Film zu machen. Sie sagen, das Publikum dürfe
nicht urteilen nach schön-häßlich, sondern müsse den Film sehen, weil
er 'wichtig' sei. Die Kritik müsse ästhetische Kriterien vergessen, weil
es ein 'wichtiger' Film sei, der unbedingt hätte gemacht werden müssen
etc. Ich glaube nicht, daß es Serie-A-Themen und Serie-B-Themen gibt.
(...) gegenüber einem Kino der feststehenden Antworten bevorzuge ich ein
Kino der Fragen." [62]
Was die vielen in den Filmrezensionen zitierten Vorbilder Morettis anbelangt,
so gibt es durchaus Belege dafür in Interviews mit Nanni Moretti. So ist
es, was die Komik anlangt, vor allem Buster Keaton noch vor Charlie Chaplin
und was die Erzählweise betrifft, Jacques Tati, die Moretti sehr nahe
stehen. [63] Hinsichtlich der Ich-Zentriertheit
innerhalb des Produktionsumfeldes (Drehbuch, Regie, Produktion, Hauptrolle
in einer Person vereint) besteht ein pragmatisches Näheverhältnis zu Woody
Allen, [64] den er vor allem mag,
"wenn er sich schämt, die Leute zum Lachen zu bringen." [65]
Über all dies möchte ich als eine Art Grundrahmen für die Arbeit Nanni
Morettis am Kino und für das Kino folgendes Zitat stellen, das, wie ich
glaube auch ganz gut als eine Art Selbstpositionierung seines eigenen
Filmschaffens gelten kann: "In den sechziger Jahren entstand auf der ganzen
Welt ein neues Kino. Es gefiel mir, weil es weder nur Kino-Kino noch nur
Politik-Kino war. [beispielsweise die 'Nouvelle Vague' in Frankreich oder
das 'Free Cinema' in England; A.d.V.] Es war ein Kino, das sowohl über
das Kino wie über die Realität nachdachte. Die Filme imaginierten eine
mögliche andere Realität und ein mögliches anderes Kino." [66]

6. literatur
BECKER, Jörg: Selbstbestimmung. In: ERNST, Gustav (Hrsg.): Autorenfilm - Filmautoren. Wien, 1996
DE BERNARDINIS, Flavio: Nanni Moretti. Roma, 1995
GANSERA, Rainer: italien 2. Glück und Melancholie. Gespräch mit Nanni Moretti. In: epd Film 9/94
GANSERA, Rainer: Aus der Enge getrieben. In: Falter Nr. 41, 1994
GILI, Jean A.: Nanni Moretti "Des films pour exorciser mes obsession". Entretien avec Nanni Moretti [Nanni Moretti. "Filme, um meine Obsessionen loszuweden". Unterhaltung mit Nanni Moretti]. In: Positif, Nr. 311, Jänner 1987
HOLZINGER, Silvia: Das Ein-Mann-Kino. Der römische Autor, Schauspieler, Regisseur, Produzent, Verleiher und Kinobesitzer Nanni Moretti und sein kinematografisches Werk. Wien, 1997
Interview mit Nanni Moretti in "Cinéma" Nr. 350, 1986, Paris
JOUSSE, Thierry und Nicolas SAADA: Interview mit Nanni Moretti. In: StadtkinoProgramm 258, gekürzt wiedergegeben aus: JOUSSE, Thierry und Nicolas SAADA: Cannes '94 Journale intime. Entretien avec Nanni Moretti. In: Cahiers du Cinéma, Nr. 479/480, Mai 1994
JOUSSE, Thierry und Nicolas SAADA: Cannes '94 Journale intime. Entretien avec Nanni Moretti. In: Cahiers du Cinéma, Nr. 479/480, Mai 1994
MONACO, James: Film verstehen. Reinbek bei Hamburg, 1990
TESSON, Charles: Comme un nageur solitaire ... Entretien avec Nanni Moretti [Wie ein einsamer Schwimmer ... Unterhaltung mit Nanni Moretti]. In: Cahiers du Cinéma, Nr. 31, Jänner 1987
WUSS, Peter: Kunstwerk des Films und Massencharakter des Mediums. Berlin, 1990
ZIMMERMANN, Gernot: "Nicht Staatsbürger, nur Zuschauer". In: WirtschaftsWoche Nr. 49, 1. Dezember 1994
und die Filme von Nanni Moretti:
"Ecce Bombo" (I, 1978, Filmalpha/Alphabeta)
"Sogni d'oro" (I, 1981, Operafilm/Raiuno)
"Bianca" (I, 1984, Faso Film/Reteitalia)
"La messa è finita" (I, 1985, Faso Film)
"Palombella rossa" (I/F, 1989, Sacher Film/Banfilm mit SOFINA und Raiuno)
"Caro diario" (I/F, 1993, Sacher Film/Banfilm/La Sept mit Raiuno und Canal plus)
in der italienischen Originalversion

[1] MONACO, James: Film verstehen. Reinbek bei Hamburg,
1990, S.403
[2] Ebda, S.386
[3] WUSS, Peter: Kunstwerk des Films und Massencharakter
des Mediums. Berlin, 1990, S.335
[4] zitiert nach MONACO, James: a.a.O., S.365
[5] Ebda, S.366
[6] BECKER, Jörg: Selbstbestimmung. In: ERNST, Gustav
(Hrsg.): Autorenfilm - Filmautoren. Wien, 1996, S.25
[7] vgl. DE BERNARDINIS, Flavio: Nanni Moretti. Roma,
1995, S.25
[8] übersetzt nach dem Interview von Charles TESSON
mit Nanni Moretti: Comme un nageur solitaire ... Entretien avec Nanni
Moretti [Wie ein einsamer Schwimmer ... Unterhaltung mit Nanni Moretti].
In: Cahiers du Cinéma, Nr. 31, Jänner 1987, S.8
[9] vgl. HOLZINGER, Silvia: Das Ein-Mann-Kino. Der römische
Autor, Schauspieler, Regisseur, Produzent, Verleiher und Kinobesitzer
Nanni Moretti und sein kinematografisches Werk. Wien, 1997, S.30
[10] vgl. Interview von Charles TESSON mit Nanni Moretti:
a.a.O., S.8
[11] vgl. Ebda, S.8
[12] vgl. HOLZINGER, Silvia: a.a.O., S.31f und DE BERNARDINIS,
Flavio: a.a.O., S.26ff
[13] Antwort auf eine Frage von Danielle HEYMAN von
"le Monde" auf einer Pressekonferenz zum französischen Kinostart von "La
messa è finita"; Quelle leider unbekannt.
[14] vgl. HOLZINGER, Silvia: a.a.O., S.41f
[15] GANSERA, Rainer: italien 2. Glück und Melancholie.
Gespräch mit Nanni Moretti. In: epd Film 9/94, S.26
[16] vgl. HOLZINGER, Silvia: a.a.O., S.44
[17] HOLZINGER, Silvia: a.a.O., S.92
[18] übersetzt nach dem Interview von Jean A. GILI
mit Nanni Moretti: Nanni Moretti "Des films pour exorciser mes obsession".
Entretien avec Nanni Moretti [Nanni Moretti. "Filme, um meine Obsessionen
loszuweden". Unterhaltung mit Nanni Moretti]. In: Positif, Nr. 311, Jänner
1987
[19] Ebda
[20] vgl. HOLZINGER, Silvia: a.a.O., S.47 und JOUSSE,
Thierry und Nicolas SAADA: Interview mit Nanni Moretti. In: StadtkinoProgramm
258, gekürzt wiedergegeben aus: JOUSSE, Thierry und Nicolas SAADA: Cannes
'94 Journale intime. Entretien avec Nanni Moretti. In: Cahiers du Cinéma,
Nr. 479/480, Mai 1994, S.55-61
[21] übersetzt nach dem Interview von Charles TESSON
mit Nanni Moretti: a.a.O., S.9
[22] übersetzt nach dem Interview von Jean A. GILI
mit Nanni Moretti: a.a.O.
[23] Ebda
[24] vgl. JOUSSE, Thierry und Nicolas SAADA: Interview
mit Nanni Moretti. In: StadtkinoProgramm 258, gekürzt wiedergegeben aus:
JOUSSE, Thierry und Nicolas SAADA: Cannes '94 Journale intime. Entretien
avec Nanni Moretti. In: Cahiers du Cinéma, Nr. 479/480, Mai 1994, S.55-61
[25] vgl. GANSERA, Rainer: a.a.O., S.24f und JOUSSE,
Thierry und Nicolas SAADA: Cannes '94 Journale intime. Entretien avec
Nanni Moretti. In: Cahiers du Cinéma, Nr. 479/480, Mai 1994, S.55-61
[26] GANSERA, Rainer: a.a.O., S.25
[27] selbstübersetztes Zitat aus: "Sogni d'oro"
(1981)
[28] selbstübersetztes Zitat aus: Ebda
[29] selbstübersetztes Zitat aus: "Bianca" (1984)
[30] selbstübersetztes Zitat aus: "La messa è finita"
(1985)
[31] vgl. HOLZINGER, Silvia: a.a.O., S.49
[32] Ebda, S.49f
[33] vgl. Ebda, S.52
[34] GANSERA, Rainer: a.a.O., S.24
[35] selbstübersetztes Zitat aus: "Bianca" (1984)
[36] selbstübersetztes Zitat aus: Ebda
[37] selbstübersetztes Zitat aus: Ebda
[38] selbstübersetztes Zitat aus: Ebda
[39] vgl. HOLZINGER, Silvia: a.a.O., S.53
[40] übersetztes Zitat aus: "Caro diario" (1993)
[41] vgl. JOUSSE, Thierry und Nicolas SAADA: Interview
mit Nanni Moretti. In: StadtkinoProgramm 258, gekürzt wiedergegeben aus:
JOUSSE, Thierry und Nicolas SAADA: Cannes '94 Journale intime. Entretien
avec Nanni Moretti. In: Cahiers du Cinéma, Nr. 479/480, Mai 1994, S.55-61
[42] selbstübersetztes Zitat aus: "Caro diario"
(1993)
[43] selbstübersetztes Zitat aus: "Ecce Bombo"
(1978)
[44] HOLZINGER, Silvia: a.a.O., S.55
[45] vgl. Ebda, S.57 und S.59
[46] vgl. GANSERA, Rainer: a.a.O., S.26
[47] vgl. HOLZINGER, Silvia: a.a.O., S.44
[48] selbstübersetztes Zitat aus: "Sogni d'oro"
(1981)
[49] selbstübersetztes Zitat aus: "Ecce Bombo"
(1978)
[50] vgl. Interview von Charles TESSON mit Nanni Moretti:
a.a.O. und Interview von Jean A. GILI mit Nanni Moretti: a.a.O.
[51] ZIMMERMANN, Gernot: "Nicht Staatsbürger, nur Zuschauer".
In: WirtschaftsWoche Nr. 49, 1. Dezember 1994, S.83
[52] selbstübersetztes Zitat aus: "Ecce Bombo"
(1978)
[53] selbstübersetztes Zitat aus: "Palombella rossa"
(1989)
[54] selbstübersetztes Zitat aus: "Palombella rossa"
(1989)
[55] übersetzt nach dem Interview von Jean A. GILI
mit Nanni Moretti: a.a.O., vgl. auch GANSERA, Rainer: a.a.O., S.24
[56] vgl. Interview von Jean A. GILI mit Nanni Moretti:
a.a.O.
[57] übersetzt nach dem Interview von Charles TESSON
mit Nanni Moretti: a.a.O., S.9
[58] übersetzt nach dem Interview von Jean A. GILI
mit Nanni Moretti: a.a.O.
[59] GANSERA, Rainer: Aus der Enge getrieben. In: Falter
Nr. 41, 1994, S.17
[60] GANSERA, Rainer: italien 2. Glück und Melancholie.
a.a.O., S.26
[61] übersetzt nach einem Interview mit Nanni Moretti
in "Cinéma" Nr. 350, 1986, Paris, S.2
[62] GANSERA, Rainer: italien 2. Glück und Melancholie.
a.a.O., S.25
[63] vgl. Interview mit Nanni Moretti in "Cinéma" Nr.
350, 1986, Paris, S.2
[64] vgl. Interview von Jean A. GILI mit Nanni Moretti:
a.a.O.
[65] übersetzt nach einem Interview mit Nanni Moretti
in "Cinéma" Nr. 350, 1986, Paris, S.2
[66] GANSERA, Rainer: italien 2. Glück und Melancholie.
a.a.O., S.25
links
best nanni moretti-pages on the web:
(c) 1998 Markus A. Mascelli